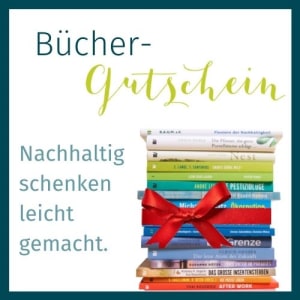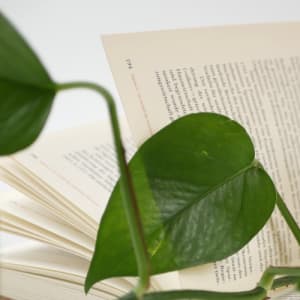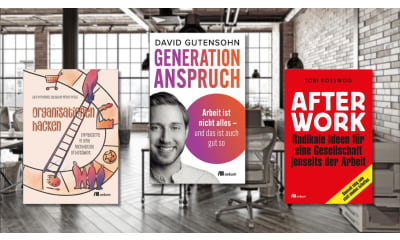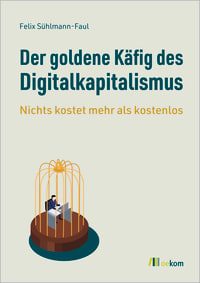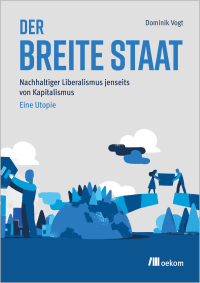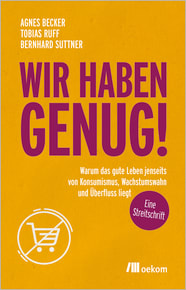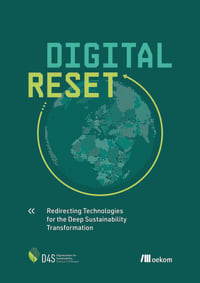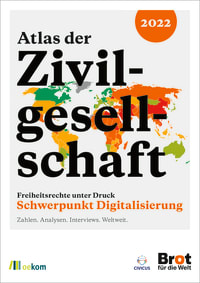»Demokratie bedeutet, immer Alternativen zu haben«
Schwindende Ressourcen, übernutzte Lebensgrundlagen, Millionen auf der Flucht, dazu Abschottungs- und Nationalisierungstendenzen diesseits und jenseits des Atlantiks. Ein Gespräch mit dem früheren Bundesumweltminister Klaus Töpfer über die Verantwortung Deutschlands, der Welt Nachhaltigkeit vorzuleben und den demokratischen Wert der Erneuerbaren. Aus der politischen ökologie 148 (2017).
11.06.2024

|
In memoriam |
Die Verabschiedung der SDGs und des Klimaabkommens von Paris gelten als Meilensteine internationaler Nachhaltigkeitspolitik. Bekommt die Große Transformation dadurch jetzt den nötigen Schub?
Klaus Töpfer: Seit der Verabschiedung dieser beiden Vereinbarungen vor anderthalb Jahren hat sich leider einiges verändert. Wir haben in den USA einen neuen Präsidenten, der zu Fragen dieser Art eine – um es vorsichtig zu sagen – andere Grundeinstellung hat. In Europa läuft in verschiedenen Ländern eine populistische Renationalisierungsdebatte. Und das zu einer Zeit, wo die negativen Auswirkungen menschlichen Handelns auf die natürlichen Lebensgrundlagen weltweit immer deutlicher spürbar werden. Geradezu widersinnig zu glauben, dass man damit alleine klar kommen könnte! Mit Blick auf die Nachhaltigkeit ist es zwar großartig, dass durch die Agenda 2030 endlich der Lebensstil und die Entwicklungsstrukturen der hochentwickelten Länder infrage gestellt werden. Trotzdem sehe ich mit sehr großer Sorge, dass es auch in Deutschland und Europa Gegenströmungen gibt und wissenschaftliche Fakten nicht mehr zur Kenntnis genommen werden.
Haben Debatten um Postwachstum und einen genügsameren Lebensstil in diesem »postfaktischen« gesellschaftlichen Klima, das rechten Parteien enormen Zulauf beschert, überhaupt eine Chance?
Wir müssen das Aufflammen des Populismus und das Erstarken des rechten Rands sehr ernst nehmen. Und wir müssen in der Diskussion über ökologische Notwendigkeiten und die konkrete Umsetzung der 17 SDGs deutlich machen, dass es dabei schon heute um Überlebensfragen für uns als Menschheit geht. Menschen wenden sich dann von Wissenschaft und Politik ab, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eigentlich keine Alternativen mehr haben. Demokratie bedeutet, immer Alternativen zu haben. Immer wieder habe ich deshalb darauf hingewiesen, dass eine Gesellschaft, deren Unwort des Jahres 2010 »alternativlos« lautet, sich damit abfinden muss, Wutbürger zu haben. Wir müssen wieder mehr dafür sorgen, Alternativen zum Status quo deutlich zu machen.
Diese Alternativen dürfen aber nicht permanent mit dem Wort Verzicht einhergehen, sondern mit der Freude an einem anderen, besseren Leben. Und wir müssen sehr klar sagen, dass das alles eine ökologische Dimension hat, mit der aber natürlich auch soziale Konsequenzen verbunden sind. Nachhaltigkeit ist nicht Ökologie allein, sondern hat etwas zu tun mit sozialer und ökonomischer Stabilität.
Die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und der Agenda 2030 könnte die gesellschaftlichen Verteilungskämpfe noch einmal verschärfen. Wie lässt sich konstruktiv gegensteuern?
Jeder Wechsel, jede größere Veränderung bringt einigen Menschen neue Perspektiven und Chancen, während andere dadurch Perspektiven und Chancen verlieren. Wenn es beispielsweise erforderlich ist – und es ist erforderlich –, dass wir in absehbarer Zeit aus der Kohleverstromung in Deutschland aussteigen, dann müssen wir sehen, dass das Konsequenzen für die Lebensentwürfe der Menschen hat, die in der Lausitz oder im Rheinischen Revier leben. Wir können nicht einfach über ihre Nöte hinweggehen. Nein, wir müssen die betroffenen Menschen schon mit Angeboten dahin bringen, dass sie den Wandel mittragen können. Ein Verteilungskampf ist immer dann zu befürchten, wenn einer sagt: »Mich interessiert gar nicht, was du für Nachteile hast, sondern ich sehe nur meine Vorteile«. Die Transformation wird mit deutlich geringeren Spannungen ablaufen, wenn wir uns genauso Gedanken machen über die Menschen, die dabei verlieren, wie wir uns darüber freuen, dass andere dabei gewinnen.
Die Transformation findet in einer Zeit statt, in der aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen und schlechter werdender Umweltbedingungen Millionen Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Was kann Nachhaltigkeitspolitik zur Stabilisierung der Lage tun?
Bislang haben wir es vor allem mit Menschen zu tun, die vor grausamen kriegerischen Auseinandersetzungen, die meist auch religiöse Auseinandersetzungen sind, fliehen. Der große Strom der Klimaflüchtlinge hat noch gar nicht richtig begonnen. Deshalb müssen wir jetzt noch gezielter in Regionen investieren, in denen Armut, Hunger, Unterentwicklung und Hoffnungslosigkeit herrschen. Ziel muss sein, die Fluchtursachen zu beseitigen, die sich aus der Übernutzung oder Schädigung der natürlichen Lebensgrundlagen in solchen Regionen ergeben. Denn sonst werden die Menschen, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, unweigerlich zu den Wachstums- und Wohlstandspolen dieser Welt wandern.
Umweltpolitik soll also als vorsorgende Friedenspolitik fungieren?
Wir brauchen ein Frühwarnsystem für Konflikte. Wir müssen wissen: Wo gibt es große Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung? Wo werden durch Klimaveränderungen Produktionsmöglichkeiten in der Landwirtschaft verändert und damit Lebensgrundlagen bedroht? Und wir brauchen eine vorsorgende Abrüstungspolitik für Spannungen und vor allem Menschen, die dort hingehen, wo sich etwas zusammenbraut, um zusammen mit den Betroffenen Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.
Es gibt viele Nichtregierungsorganisationen, die damit eine große Erfahrung haben und Glaubwürdigkeit vor Ort genießen. Institutionen wie Oxfam, die Welthungerhilfe oder andere sind schon lange vor Ort. Sie sind weit mehr als die Feuerwehr, die eingreift, wenn es schon brennt. Sie machen sich zum Beispiel Gedanken darüber, wie man Saatgut weiterentwickeln kann, das Dürren besser trotzt. Oder wie sich diese fürchterlichen Verluste nach der Ernte durch Infrastrukturmaßnahmen wie Investitionen in Straßen und Kühlanlagen vermindern lassen. Das kann man als vorsorgende Friedenspolitik bezeichnen, weil sie sich bemüht, Katastrophen zu vermeiden.
Welche Rolle kann ein reiches Land wie Deutschland in diesem Prozess spielen?
Deutschland und Europa können der Welt zeigen, dass nachhaltig zu leben bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Die Energiewende zeigt, dass reiche Länder Technologien entwickeln können, die vielen Zugang ermöglicht. Erneuerbare Energien sind ja nicht nur mit Blick auf ihre ökologischen Vorteile von hoher Bedeutung, sie sind es auch für die Demokratie. Denn plötzlich haben viele Menschen die Möglichkeit, an Entscheidungen über Energiefragen mitzuwirken. Wir haben hierzulande über 900 Energiegenossenschaften. Tausende von Menschen machen sich Gedanken, wie sie Energie selbst erzeugen können. Sie gestalten so den technologischen Fortschritt aktiv mit und sind nicht länger Objekt, sondern Subjekt von Forschung und Entwicklung.
Es zeigt sich außerdem mehr und mehr, dass die Energiewende nicht etwas ist, das sich nur reiche Länder leisten können. Ganz im Gegenteil, sie bietet auch armen Ländern Entwicklungschancen, die damit ihre eigene Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen produzieren können. Erneuerbare sind eine demokratiefähige Technologie, die viel zur Stabilität einer Welt mit neun Milliarden Menschen beitragen kann.
Das Interview führte Anke Oxenfarth