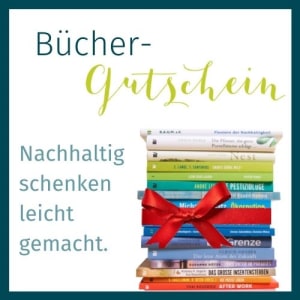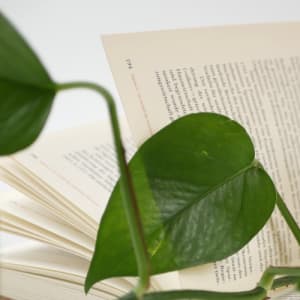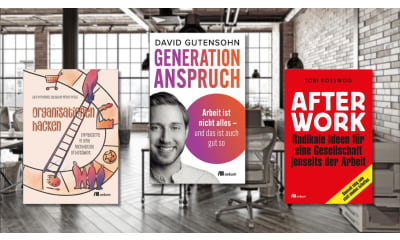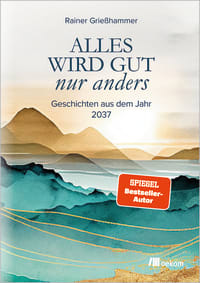Globale Klimagerechtigkeit durch Vergesellschaftung?
Vergesellschaftung als Enteignung von Privateigentum zielt darauf ab, eine Form des Wirtschaftens zu realisieren, in der das Gemeinwohl und nicht die Profite einiger weniger im Mittelpunkt steht. Dies birgt aus Perspektive der Klimagerechtigkeit das Potenzial, gleichzeitig soziale Ungerechtigkeit zu reduzieren, die Erderhitzung zu stoppen und die Biosphäre als Ganzes zu schützen. Dafür müssen geeignete Beteiligungsverfahren entworfen werden, erklärt Andrina Freitag (Kippunkt-Kollektiv) in ihrem Beitrag aus »Vergesellschaftung und die sozialökologische Frage«.
17.06.2024

Die vielfachen ökologischen und sozialen Krisen der Gegenwart offenbaren einen grundlegenden Widerspruch, den der Kapitalismus in keiner seiner Ausprägungen lösen kann: Die kapitalistische Produktionsweise ist auf Profit und ständiges Wirtschaftswachstum ausgerichtet, während der Planet, auf dem wir leben, nicht über unendliche Naturgüter verfügt. (1) Zudem sind die Prozesse und Systeme innerhalb der Biosphäre der Erde, welche die Grundlage jeglichen Lebens bilden, dynamisch-fragil. (2) Sie sind durch eine imperiale Produktions- und Lebensweise unter der Vorherrschaft hauptsächlich weißer (3) Menschen unter starken Druck geraten. Die Folgen und Kosten dieser Entwicklung betreffen dabei aber nicht alle Menschen gleichermaßen, sondern verschärfen bereits bestehende soziale Ungleichheiten. Ebendiesen Umstand und die Rolle vergangener sowie aktueller Machtverhältnisse erfasst und priorisiert der Ansatz der Klimagerechtigkeit.
Inwiefern Vergesellschaftung zur Lösung der gegenwärtigen Krisen beitragen kann, soll im Folgenden durch das Konzept der Klimagerechtigkeit (4) erörtert und diskutiert werden. Warum und unter welchen Bedingungen bietet Vergesellschaftung einen Ansatzpunkt, um gleichzeitig die Klimaerhitzung zu reduzieren, die Biosphäre als Ganzes zu schützen und zur Überwindung von sozialer Ungleichheit – insbesondere in Bezug auf rassistische Zuschreibungen (5), Geschlecht und Klasse, aber auch weitere Diskriminierungen – beizutragen? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich hierbei – vor allem aus einer diskriminierungssensiblen und machtkritischen Perspektive – für eine sozialökologisch gerechte Transformation?
Klimagerechtigkeit und Vergesellschaftung
Im gegenwärtigen hegemonialen kapitalistischen Kompromiss (6) werden Menschen und ihre verschiedenen Tätigkeiten über den Marker Arbeit weltweit auf sehr unterschiedliche Weise – als ausgebeutete oder enteignete, bezahlte, unterbezahlte oder nicht bezahlte Arbeitende, als Produktiv- oder Reproduktivkräfte und als Konsumierende – eingebunden und für die Kapitalakkumulation (7) genutzt. (8) Die sich hieraus ergebende »systematic and hierarchic division of labour« (9) korreliert mit Grenzziehungsprozessen, welche Differenzen anhand der Marker Rasse und Geschlecht, aber auch beispielsweise sexueller Orientierung, Religion, Herkunft, Be_hinderung (10) oder Alter, in Bezug auf die Kategorie Klasse konstituieren. Durch komplexe und intersektional wirkende Kombinationen und Verflechtungen von Ungleichheiten wird so nicht nur der ökonomische Status einer Person bestimmt, sondern auch die soziale Position – in Form von Subjektpositionen und Identitäten – die Menschen einnehmen können oder müssen. (11) In Bezug auf die Klimakrise ergeben sich folgende Aspekte, (12) deren Betonung und Anerkennung zentral für den Klimagerechtigkeitsansatz sind:
- Je nach sozialer Positionierung tragen Menschen ganz unterschiedlich zur Erhitzung des Erdklimas und zur Zerstörung des Erdsystems bei.
- Gleichzeitig sind die Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen beziehungsweise beigetragen haben, derzeit und in Zukunft am stärksten von den Folgen der Klimaerhitzung betroffen.
- Diese können sich zudem am wenigsten vor der Krise schützen und an die damit einhergehenden Veränderungen anpassen.
- Sie haben dabei wenige bis gar keine Möglichkeiten zur politischen Mitsprache und Gestaltung zur Bearbeitung der Krise.
Die Klimakrise beziehungsweise alle weiteren ökologischen Krisen werden hier gleichzeitig als soziale Krisen verstanden. Daraus ergibt sich ferner, dass diese Krisen nicht getrennt voneinander zu lösen sind, sondern nur im Zusammenhang miteinander. (13)
Die Ursprünge der zuvor beschriebenen Ungerechtigkeiten beruhen nicht nur auf der beschriebenen Hierarchisierung von Menschen, sondern sie sind auch mit einem bestimmten Modell von Eigentum verknüpft. Beides ist konstitutiv für die kapitalistische Produktionsweise und eine Voraussetzung, um die Kapitalakkumulation möglichst hochzuhalten. (14) Konkret bedeutet dies, dass die Produktionsmittel (15) üblicherweise im Besitz von Privatpersonen oder Unternehmen sind. In der Folge sind diese Besitzenden allein diejenigen, die die Produktionskräfte kontrollieren, die Bedingungen der Produktion festlegen und über den generierten Mehrwert entscheiden können. Hier zeigt sich der undemokratische Charakter des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Menschen haben als Arbeitende bestimmter Betriebe oder Unternehmen kaum Möglichkeiten zu beeinflussen, was und wie produziert wird. Demokratische Entscheidungsmöglichkeiten sind in der Regel auf das politische Feld beschränkt. (16)
»Vergesellschaftung bricht mit dem gegenwärtig hegemonialen Modell von privatem Eigentum. «
Im Gegensatz dazu bricht Vergesellschaftung mit dem gegenwärtig hegemonialen Modell von privatem Eigentum. Durch die Enteignung von Produktionsmitteln in Privateigentum und deren Übertragung an die Gemeinschaft kann eine Form des Wirtschaftens und Zusammenlebens realisiert werden, in der das Gemeinwohl und die Bedürfnisse von Menschen und nicht die Profite einiger weniger im Mittelpunkt stehen. (17) Planung und Koordination sowie die Entscheidung über erwirtschaftete Überschüsse, Reichtum und Wohlstand liegen dann nicht in den Händen weniger, sondern in der Verantwortung der Gemeinschaft. (18)
Damit Vergesellschaftung zu mehr Klimagerechtigkeit führt, sollte diese mit einer grundsätzlichen Demokratisierung des ökonomischen Feldes einhergehen. Gemeinschaftliches Eigentum soll in diesem Sinne durch demokratische und gesellschaftliche Prozesse organisiert und verwaltet sein. Entscheidungsstrukturen, die eine gleichberechtigte Teilnahme derjenigen, die direkt oder indirekt betroffen sind, ermöglicht, sind hiernach zentral für ein klimagerechtes Zusammenleben. (19)
Dies gilt besonders, wenn es darum geht, globale Ungerechtigkeit zu bearbeiten, genauso wie für die Organisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und reproduktiver Tätigkeiten. Veränderungen und Forderungen können so im Sinne der Klimagerechtigkeit direkt von den betroffenen Menschen eingebracht und verhandelt werden. Damit können sie die Gestaltung ihrer Lebensumstände, Umwelt und Arbeitszusammenhänge selbst untereinander abstimmen. Gleichzeitig lassen sich auf diese Weise Formen des Wirtschaftens und eine Gesellschaft, die solidarisch und ohne Ausschlüsse auskommt, realisieren. So kann Vergesellschaftung einen emanzipatorischen Charakter annehmen. (20)
Klimagerecht vergesellschaften: Chancen
Vergesellschaftung kann dann klimagerecht sein, wenn die Überwindung struktureller Diskriminierungen und der bereits beschriebenen hierarchischen globalen Arbeitsteilung (21) als Ziel festgelegt wird. Wie Theorien des Racial Capitalism oder Theorien der sozialen Reproduktion betonen, sind solche Ungerechtigkeiten konstitutiv für den Kapitalismus und müssen im Rahmen von Vergesellschaftung infrage gestellt werden. In einer Wirtschaft ohne Ausschließungen und Hierarchien reduziert sich soziale Ungerechtigkeit. (22)
Klimagerecht zu vergesellschaften, bedeutet in diesem Kontext, zunächst einmal anzuerkennen, dass sich die aktuelle kapitalistische Dienstleistungsgesellschaft und Produktionsweise durch eine rassistische und patriarchale Grundlogik auszeichnen. In Bezug auf Rassismus bedeutet dies, dass rassistische Denkmuster und Diskriminierungen beeinflussen, wer unter welchen Konditionen Zugang zu verschiedenen Formen von Arbeit im Sinne von freier Lohnarbeit, enteigneter oder ausgebeuteter Arbeit hat. (23)
Über rassifizierte Grenzziehungsprozesse werden Menschen, ihren Identitäten und Körpern unterschiedliche Werte zugeschrieben. Anhand dieser entscheidet sich, ob es sich um bezahlte, unterbezahlte oder nichtbezahlte Arbeit handelt und wie sich nicht nur die Arbeits-, sondern auch die Lebensbedingungen der betreffenden Menschen unter voranschreitender Klimaerhitzung gestalten. So wird die hierarchische globale Arbeitsteilung zu einer »racially hierarchical organization of global space« (24).
Diese materialisiert sich am deutlichsten in den unterschiedlichen (Re-)Produktionsverhältnissen und Lebensweisen im Globalen Norden im Unterschied zu Regionen und Ländern des Globalen Südens beziehungsweise zwischen weißen und rassifizierten Menschen. Ohne Rassismus wären weder die sogenannte ursprüngliche Akkumulation (25) im Rahmen von Kolonialismus noch die gegenwärtigen Formen von Enteignungen und Ausbeutungen von Menschen, Boden und Naturgütern – sprich der Biosphäre – möglich. Diese sind heute genauso wie gestern die Grundlage für die Profite kapitalistischer Unternehmen. (26)
Eine ähnliche strukturelle Ungleichheit ist in Bezug auf gegenwärtig dominierende patriarchale und sexistische (Re-) Produktionsverhältnisse zu konstatieren. Im aktuellen kapitalistischen System werden Reproduktions- und Sorgearbeiten, die grundlegend für alle weiteren wirtschaftlichen Aktivitäten und für den Erhalt der Gesellschaft insgesamt sind, schlecht oder gar nicht bezahlt. Sie werden hauptsächlich von Frauen, weiblich sozialisierten Personen, rassifizierten Menschen sowie von Menschen mit geringerem Einkommen geleistet. (27)
»Um mehr Klimagerechtigkeit zu erlangen, muss unter anderem das Verhältnis von bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten verhandelt, neu bewertet und umverteilt werden. «
Vergesellschaftung bietet hier die Chance, in demokratisch organisierte Koordinierungs- und Planungsprozessen zu reflektieren und zu überlegen, wie den beschriebenen Ungerechtigkeiten beizukommen ist. Um mehr Klimagerechtigkeit zu erlangen, muss unter anderem das Verhältnis von bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten verhandelt, neu bewertet und umverteilt werden. Sichere, faire und nachhaltigere Arbeitsbedingungen und eine allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit sind dabei weitere wichtige Schritte im Sinne der Klimagerechtigkeit. (28)
Konkrete wirtschaftliche Koordinations- und Planungsprozesse sind noch aus einem weiteren Grund relevant, wenn es darum geht, den ökologischen Krisen – allen voran der Klimaerhitzung – durch Vergesellschaftung beizukommen. Sind diese Prozesse nämlich demokratisch und partizipativ gestaltet, können Menschen selbst darüber entschieden, was in welcher Menge und unter welchen Bedingungen produziert wird und welche Dienstleistungen bereitgestellt werden. Gleiches gilt in Bezug auf die Organisation des Konsums: Wer bekommt wie viel wovon und unter welchen Bedingungen? (29)
Dabei müssen aus Klimagerechtigkeitsperspektive materielle Güter wie Nahrungsmittel, Kleidung, Wohnen, die zur ausreichenden Erfüllung der Grundbedürfnisse nötig sind, und die soziale und öffentliche Daseinsvorsorge wie Bildung, Care-Arbeit, Gesundheit, Pflege, Mobilität oder Energie emissionslos, ressourcenschonend und ökologisch nachhaltig ausgebaut werden. (30)
Wenn nicht mehr ausschließlich der Markt, der sich durch Angebot und Nachfrage, Wettbewerb und (künstliche) Knappheit auszeichnet, den Zugang zu und die Verfügbarkeit von all jenen Dingen und Dienstleistungen, die zur Erfüllung der Grundbedürfnisse nötig sind, regelt, sondern diese zu einem selbstverwalteten Gemeingut werden, über das Menschen selbst verhandeln und bestimmen können, kann Klimagerechtigkeit erreicht werden. Denn dann entscheidet nicht mehr die soziale Positionierung darüber, ob und wie Menschen lebenserhaltende Güter und Dienstleistungen beziehen können, sondern die Verteilung wird zu einer Frage von Bedürfnissen. (31)
Zusätzlich zur Vergesellschaftung müssen emissionsstarke und umweltschädliche Praktiken sowie Logiken der aktuellen imperialen Lebens- und Produktionsweise (32) verboten und überwunden werden. Auf diese Weise kann der dringend benötigte Verbrauch an Energie und Material drastisch gesenkt werden. Gleichzeitig kann beispielsweise auch der Kreislauf von Konsum und Verschleiß durchbrochen und im Gegenzug dazu die Qualität von Gütern verbessert werden. (33) Eine klimagerechte Vergesellschaftung ist nur in Kombination mit Degrowth realisierbar, um die Folgen für all jene, die jetzt schon am stärksten betroffen sind, nicht noch weiter zu verstärken und insgesamt für alle Menschen einen möglichst lebenswerten Planeten zu erhalten. (34)
Klimagerecht vergesellschaften: Herausforderungen
Einige der eben beschriebenen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Zugang zu Bildung oder die Verteilung von Wohnraum, die zentral für eine klimagerechte Vergesellschaftung sind, können eher auf der lokalen Ebene verhandelt und kontextabhängig angepasst werden. Viele andere Ungerechtigkeiten lassen sich aber nur auf globaler Ebene durch die Inklusion vieler verschiedener Akteur*innen lösen, wie zum Beispiel die Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Rohstoffe, die benötigt werden, um die Technik für eine solche Energiegewinnung bauen zu können, sind geografisch unterschiedlich verfügbar. (35) Gleiches gilt für Elektromobilität als Anker einer Verkehrswende hin zu einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr.
»Klimagerecht zu vergesellschaften bedeutet deswegen, Umverteilungsmaßnahmen auf globaler Ebene einzuleiten.«
Hinzu kommt, dass sich unter voranschreitender Klimakrise und Veränderungen in der Biosphäre (36) die Bedingungen, Möglichkeiten und Räume für ökologisch nachhaltige Handlungen einschränken werden. Der Zugang zu bewohnbaren und lebenswerten Orten sowie zu Süßwasser und den Flächen, auf denen der Anbau von Lebensmitteln möglich ist, wird sich zunehmend verringern und damit sowohl die sozialökologische Transformation in höchstem Maße beeinflussen als auch die Frage nach einer gerechten Verteilung mehr denn je verschärfen. (37)
Klimagerecht zu vergesellschaften bedeutet deswegen, Umverteilungsmaßnahmen auf globaler Ebene einzuleiten. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass all jene Menschen, die im gegenwärtigen kapitalistischen System ausgebeutet, benachteiligt und unterdrückt werden, in dem alternativen System bessergestellt sind. Planungsprozesse in Bezug auf Produktions- und Dienstleistungsweisen, Konsum und öffentliche Daseinsvorsorge müssen hierfür also mit konkreten Umverteilungen kombiniert werden.
Dabei werden die Effekte für jene Menschen, die aktuell an eine imperiale Lebensweise gewöhnt sind, andere sein als für Menschen, die gegenwärtig eine marginalisierte Position einnehmen. Hinzu kommt hier außerdem, dass die Profiteur*innen einer imperialen Lebens- und Produktionsweise, die deswegen im aktuellen hegemonialen Kompromiss materielle, soziale und psychologische Vorteile genießen, mit Veränderungen konfrontiert sind, welche sie als Verlust und Einschränkungen wahrnehmen können.
Das bedeutet, es ist nicht gegeben, dass diese in partizipativen Planungsprozessen solidarische und gerechte Arbeitsbedingungen, Degrowth- und Umverteilungsmaßnahmen automatisch einleiten beziehungsweise diesen zustimmen werden. Hier kommt zum Tragen, dass die für den Kapitalismus spezifischen Grenzziehungsprozesse nicht nur auf im ökonomischen, sondern auch auf im politischen wie kulturellen Bereich reproduziert werden. Sie sind grundlegend für die Herstellung von Bedeutungen (38) und damit für die Wahrnehmung und Interpretation sozialer Wirklichkeit und (kollektiver) Identitäten.
»Diejenigen, die von einer Entscheidung betroffen sind, sollten diejenigen sein, die die Entscheidung treffen.«
Kapitalismus als ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis zu begreifen, bedeutet, dass es sich bei der Etablierung einer alternativen Wirtschaftsform im Sinne von Vergesellschaftung auch um ein gesamtgesellschaftliches Projekt handeln muss, das nicht nur auf die Wirtschaft begrenzt bleibt. Es ist also zentral, darüber nachzudenken, wie demokratische Beteiligungsverfahren aufgebaut sein müssen, damit »gemeinwohlorientiert« nicht beschränkt auf eine bestimmte Gruppe bleibt (39) und Vergesellschaftung – welche Form sie genau annimmt, wird je nach Kontext variieren (40) – wirklich klimagerecht sein kann.
Hier wird grundsätzlich vorgeschlagen, dass all jene, die von einer Aktivität betroffen sind, gleichberechtigt an der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit beteiligt sind, und zwar in dem Maße, in dem sie von ihr betroffen sind. Oder in anderen Worten, diejenigen, die von einer Entscheidung betroffen sind, sollten diejenigen sein, die die Entscheidung treffen. (41) Nur so kann zum Beispiel sichergestellt werden, dass Forderungen nach fairen und gerechten Arbeitsbedingungen formuliert und umgesetzt werden, klimafreundliche Methoden der Energiegewinnung und der Ausbau der sozialen Infrastruktur vorangetrieben, umweltschädliche Praktiken in Wohnorten und Lebensräumen verboten und solidarische Lösungen in Bezug auf die Folgen und die Anpassung im Zuge der Klimaerhitzung gefunden werden.
Die Liste potenziell Beteiligter ist lang, und die Auswahl wird je nach genauer Tätigkeit, Produktionsweise, Organisation und Kontext variieren. Nach Margaret Lund (42) können drei Kategorien potenzieller Mitglieder unterschieden werden:
- Nutzer*innen (z. B. Verbraucher*innen, Erzeuger*innen, institutionelle Abnehmer*innen, Händler*innen)
- Erzeuger*innen (z. B. Arbeiter*innen, Angestellte)
- unterstützende Mitglieder (z. B. Mitglieder der Gemeinschaft, Gemeinden und Regionen sowie unter Umständen einzelne Interessengruppen, die sich z. B. für die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt oder soziale Gerechtigkeit interessieren). (43)
Klar ist, je nach Art und Wirkungsgrad der Tätigkeit müssen dabei regionale, nationale oder transnationale Planungs- und Entscheidungskommissionen eingesetzt werden, um alle betroffenen Menschen ausreichend erreichen und inkludieren zu können. Hierbei gilt es, zu beachten und anzuerkennen, dass schon heute im Sinne einer diverse economy (44) eine Vielzahl an Lösungsansätzen und alternativen Wirtschaftsweisen existiert. Diese sichtbar zu machen, zu stärken und auszubauen, ist von essenzieller Bedeutung, um Klimagerechtigkeit herzustellen.
Fazit
Um für alle Menschen ein klimagerechtes Zusammenleben zu etablieren, das die Biosphäre schützt und einen bewohnbaren Planeten für gegenwärtige wie zukünftige Generationen und andere Lebensformen sichert, können Vergesellschaftungsprozesse einen wichtigen Baustein darstellen. Vorangegangenes macht aber deutlich, dass aus einer Klimagerechtigkeitsperspektive in aktuellen Überlegungen zu und Forderungen nach Vergesellschaftung sichergestellt sein muss, dass es zu keiner Übernahme, Reproduktion oder Neuformulierung der existierenden globalen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten kommt.
Damit einher geht vor allem, dafür sensibel zu sein, dass je nach geografischer beziehungsweise sozialer Positionierung die Bedürfnisse und damit die Interessen – in Bezug auf ein gutes Leben und die Klimakrise – der Menschen unterschiedlich sind und dass zu deren gerechter Erfüllung sehr unterschiedliche Maßnahmen notwendig sein werden. (45)
Vergesellschaftung birgt dann ein emanzipatorisches Potenzial, um mit den gegenwärtig klimaschädlichen, hegemonialen und kapitalistischen Verhältnissen zu brechen, wenn die vielfachen sozialen und ökologischen Krisen der Gegenwart zusammengedacht und in direkten Bezug zu existierenden Macht- und Unterdrückungsstrukturen gesetzt werden und deren kolonialen Ursprung anerkennt. So stellen beispielsweise Eleonora Roldán Mendívil und Hannah Vögele klar:
»Für eine sozialistische Mobilisierung in allen Bereichen und Zwischenräumen müssen wir sämtliche zugeschriebene Kategorien – seien es Geschlecht, Rasse, Sexualität usw. – in ihrer Bedeutung für das kapitalistische Wirtschaftssystem verstehen und als solche theoretisch und praktisch kritisieren.«(46)
Die sozialen Kategorien, die den Kapitalismus als Produktionsweise konstituieren, müssen also im Zuge von Vergesellschaftungsforderungen aufgegriffen und kritisiert werden. Darüber hinaus muss deren Abschaffung als ein zentrales Ziel von Vergesellschaftung formuliert werden, um sie im Sinne der Klimagerechtigkeit zu denken.
Anmerkungen
1 Foster, J. B. / Clark, B. (2016): Marx’s Ecology and the Left, Monthly Review, 68 (2), S. 16.
2 Als Biosphäre wird hier die Gesamtheit aller mit Lebewesen besiedelten Schichten und Ökosysteme der Erde bezeichnet. Sie umfasst sowohl die unterste Schicht der Atmosphäre (planetare Grenzschicht) als auch die oberste Schicht der Erdkruste (Lithosphäre), einschließlich des Wassers (Hydrosphäre). Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, S. 1254. Das Klimasystem, die Prozesse in Biosphäre und soziale Systeme stehen in einem dynamischen wechselseitigen Verhältnis. Im Gegensatz zu den dominierenden wirtschaftswissenschaftlichen Ansätzen wird hier die »Natur« nicht als eine getrennte Sphäre der Ökonomie betrachtet, sondern als etwas, was in direkter Beziehung zu Formen von Produktion als auch Reproduktion steht. Siehe dazu auch: Croeser, Eve (2021): Ecosocialism and Climate Justice. An Ecological Neo-Gramscian Analysis, Routledge, S. 163.
3 Weiß meint keine Farbe oder Hautfarbe, sondern ist ein politischer Begriff und wird in internationalen Rassismusdebatte als Gegensatz zu BIPoC (Black, Indigenous and People of Color und im Deutschen für Schwarz, Indigen und Menschen of Color) verwendet. Die Hervorhebung soll die gesellschaftspolitische (Macht-)Position, Privileg und Norm, die für weiße Menschen oft unbemerkt bleibt, hervorheben und sichtbar machen.
4 Klimagerechtigkeit hat keine feststehende Definition. Der hier hergeleitete Klimagerechtigkeitsansatz bezieht sich hauptsächlich auf Theorien des Ökosozialismus, Theorien der sozialen Reproduktion und Theorien des Racial Capitalism. Alle drei Ansätze stehen dabei in einer marxistischen beziehungsweise materialistischen Denktradition und haben diese mit unterschiedlichen Schwerpunkten weiterentwickelt. Während ökozialistische Ansätze auf das Verhältnis von »Natur« und Kapitalismus fokussieren, ist das Ziel der Theorien der sozialen Reproduktion aufzuzeigen, dass im Kapitalismus ein grundlegender Zusammenhang zwischen der Reproduktion der Arbeitskräfte und der Produktion von Waren und Dienstleistungen besteht. Dagegen zentriert sich der Racial Capitalism darauf, wie rassistische Hierarchien und Diskriminierung in kapitalistischen Systemen eingebettet sind und in welchem Verhältnis beides zueinandersteht.
5 Die Formulierung »rassistische Zuschreibungen« verweist darauf, dass Rassismus auf vielfältigen rassistischen Zuschreibungen und daraus resultierenden Diskriminierungen fußt, die nicht nur rassenbiologisch, sondern auch ethisch-kulturell, national oder religiös begründet sein können. Siehe zu der historischen Entwicklung zum Beispiel Hund, Wulf D. (2007): Rassismus. Bielefeld, Transcript.
6 Hegemonie wird hier nach Antonio Gramsci verstanden. Sie beschreibt die Fähigkeit der herrschenden Klasse, die führenden Gruppen der Ausgebeuteten und Unterdrückten mittels eines Kompromisses in einen sogenannten historischen Block einzubinden. Dazu ausführlicher: Gramsci, Antonio (1992): Gefängnishefte, Bd. 4, Hamburg, S. 783, und in Bezug auf die Klimakrise Croeser, Eve (2021): Ecosocialism and Climate Justice. An Ecological Neo-Gramscian Analysis, Routledge.
7 Der Begriff beschreibt vereinfacht die Erweiterung bereits vorhandenen Kapitals beziehungsweise die Ansammlung neuen Kapitals. In Anschluss an marxistische Theorien ist der Zwang zur Akkumulation der kapitalistischen Produktionsweise strukturell inhärent, und es wird versucht durch möglichst geringe Produktionskosten die Akkumulation möglichst hochzuhalten. Daraus ergibt sich die Tendenz, Produktionsmittel, die zur Herstellung von Gütern oder Dienstleistungen erforderlich sind, möglichst kostengünstig einzubeziehen beziehungsweise anfallende Kosten zu externalisieren. Marx, Karl (2000) [1865]: Lohn, Preis, Profit. Unter: www.enteignung.com (Zugriff: 01.01.2024) und Luxemburg, Rosa 1975 [1913]): Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus.
8 Bhattacharyya, Gargi (2018): Racial Capitalism (Cultural Studies and Marxism), Rowman & Littlefield Pub, S. 67 f.; Fraser; Nancy (2022): Cannibal Capitalism. How our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet – and What We Can Do About It, Verso.
9 Hervorhebung durch die Autorin, Lebowitz, Michael A. (2003): Beyond ›Capital‹: Marx’s Political Economy of the Working Class, Basingstoke: Palgrave Macmillan, S. 1944.
10 Die Schreibweise mit einem Unterstrich macht die äußeren Umstände (zum Beispiel Bauweisen oder Strukturen), die dem be_hinderten Menschen aufgestellt werden und er*sie überwinden muss, sichtbar. Siehe dazu ausführlicher: Payk, Katharina: Hä? Was bedeutet be_hindert?, in: Missy Magazine, 12.03.2019.
11 Bafta, Sarbo (2023): Rassismus und gesellschaftliche Produktionsverhältnisse, in: Roldán Mendívil, Eleonora / Bafta, Sarbo (Hrsg.) (2023): Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus, Dietz Berlin, S. 44.
12 Ökozialistische Ansätze argumentieren, dass die Klimakrise nicht allein auf Ungleichheit zwischen Globalem Norden und Süden, sondern auf Klassenverhältnisse zurückzuführen ist. In einem kapitalistischen System sind es die materiellen Möglichkeiten von Individuen und Gemeinschaften, die bestimmen, wie sie ihre Lebensumstände gestalten können. Croeser, Eve (2021): Ecosocialism and Climate Justice. An Ecological Neo-Gramscian Analysis, Routledge, S. 164/170.
13 BUNDjugend (Hrsg.) (2021): Kolonialismus & Klimakrise. Über 500 Jahre Widerstand; Angus, I. (2016): Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System. New York: Monthly Review Press.
14 BUNDjugend (2023): Klimagerechtigkeit und Öffentlicher Luxus. Kämpfe verbinden für ein schönes Leben für alle, in: communia & BUNDjugend (2023): Öffentlicher Luxus, Dietz Berlin, S. 57 ff.
15 Produktionsmittel bezieht sich hier auf natürliche wie technologische Ressourcen, Fabriken, Werkzeuge, Maschinen, Anlagen und alles andere, was in einem Produktionsprozess verwendet wird, um Güter und Dienstleistungen herzustellen.
16 Ferras, Isabella (2023): Democratizing the Corporation: The Bicameral Form as Real Utopia, in: Politics & Society 51 (2), S. 188–193; Fraser; Nancy (2022): Cannibal Capitalism. How our System is Devouring Democracy, Care, and the Planet – and What We Can Do About It, Verso.
17 Nuss, Sabine (2019): Keine Enteignung ist auch keine Lösung. Die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums, Dietz Berlin, S. 124 f.; Communia e. V. (Hrsg.) (2023): Einleitung, in: Neue Energie für Vergesellschaftung. Vergesellschaftungsperspektiven für den Energiesektor, S. 6 f.
18 Ebd.
19 Communia (2023): Öffentlicher Luxus. Eine verheißungsvolle Zukunft. Einleitung, in: communia & BUNDjugend (Hrsg.) (2023): Öffentlicher Luxus, Dietz Berlin, S. 33 f.; Löwy, Micheal (2023): Ökosozialismus, in: Kothari, Ashish et al. (Hrsg.) (2023): Pluriversum. Ein Lexikon des Guten Lebens für alle, S. 37 f.
20 Ebd.
21 Durch verschiedene Diskriminierungs- und Ausschlusspraktiken entsteht eine hierarchische Ordnung der Weltbevölkerung als Arbeiter*innenschaft. Durch sie können Produktionskosten niedrig gehalten und somit die Kapitalakkumulation gesteigert werden. Siehe hierzu zum Beispiel Virdee, Satnam (2019): Racialized capitalism: An account of its contested origins and consolidation, in: The Sociological Review 2019, 67 (1), S. 3–27.
22 BUNDjugend (2023): Klimagerechtigkeit und Öffentlicher Luxus. Kämpfe verbinden für ein schönes Leben für alle, in: communia & BUNDjugend (2023): Öffentlicher Luxus, Dietz Berlin, S. 58.
23 Bhattacharyya, Gargi (2018): Racial Capitalism (Cultural Studies and Marxism), Rowman & Littlefield Pub, S. 56.
24 Hervorhebung durch die Autorin. McIntyre, Michael / Nast, Heidi J. (2011): Bio- (necro)polis: Marx, Surplus Populations, and the Spatial Dialectics of Reproduction and »Race«, in: Antipode, 43 (5), S. 1466.
25 Als sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet Karl Marx den historischen Ausgangspunkt der kapitalistischen Anhäufung von Kapital, der auf einer gewaltsamen Enteignung von Gemeindeeigentum und dessen Überführung in Privateigentum beruht. Marx, Karl (1968) [1867]: Das Kapital, Band I, Siebzehnter Abschnitt, S. 741 ff.
26 Melamed, Jodi (2015): Racial Capitalism. In: Critical Ethnic Studies 1 (1), S. 77–80); Fraser, Nancy (2018): Roepke Lecture in Economic Geography – From Exploitation to Expropriation: Historic Geographies of Racialized Capitalism, in: Economic Geography 94 (1), S. 1–17.
27 Dalla Costa, Mariarosa (1978): Die Frau und der Umsturz der Gesellschaft, in: Dalla Costa, Mariosa / James, Selma (1978): Die Macht der Frau und der Umsturz der Gesellschaft, Merve, S. 27–67.
28 Konzeptwerk für Neue Ökonomie (2023): Arbeitszeitverkürzung. Für die 4-Tage-Woche und ein gutes Leben für alle, in: Bausteine für Klimagerechtigkeit. 8 Maßnahmen für eine solidarische Zukunft, oekom Verlag, S. 105–132.
29 Löwy, Michael / Akbulut, Bengi / Fernandes, Sabrina / Kallis, Giorgos (2022): For an Ecosocialist Degrowth, in: Monthly Review, 73 (11).
30 Ajil, Max (2021): A People’s Green New Deal, Pluto Pres, S. 95 f.; Hickel, Jason (2023): Universal public services: The power of decommodifying survival, Monthly Review, 11.04.2023 [https://mronline.org/2023/04/21/universal-public-services/].
31 Ebd.
32 Das Konzept geht auf Ulrich Brand und Markus Wissen zurück und ermöglicht es die globale Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise, die auf der Ausbeutung von Menschen und Natur basiert, im Zusammenhang mit alltäglichen, verinnerlichten und weithin sozial akzeptierten Gewohnheiten und Handlungsweisen zu verstehen, die vor allem im Globalen Norden beziehungsweise bei privilegierten Menschen verbreitet ist. Ausführlicher in: Brand, Ulrich / Wissen, Markus (2017): Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Menschen und Natur im globalen Kapitalismus, oekom verlag.
33 Spear, Jess / Murphy, Paul (2022): Die Notwendigkeit Ökosozialismus und Degrowth zusammen zu denken [https://emanzipation.org/2022/07/die-notwendigkeit-oekosozialismus-und-degrowth-zusammen-zu-denken/].
34 Löwy, Michael / Akbulut, Bengi / Fernandes, Sabrina / Kallis, Giorgos (2022): For an Ecosocialist Degrowth, in: Monthly Review, 73 (11).
35 Ebd.
36 Wissenschaftler*innen warnen, dass sich die Biosphäre und die Ökosysteme, in die Menschen eingebettet sind, so drastisch verändern werden, dass der Planet für sie unbewohnbar wird. Steffen, W. et al. (2015). The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. The Anthropocene Review, 2 (1), S. 81–98; IPCC (2023): Summary for Policymakers, in: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, S. 5.
37 IPCC (2022): Summary for Policymakers [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf], S. 13 ff.
38 Bedeutungen illustrieren nicht einfach die Welt in der Sprache, sondern ergeben sich »aus den Differenzen zwischen Begriffen und Kategorien, den Bezugssystemen, die die Welt klassifizieren und auf diese Weise erlauben, dass sie vom sozialen Denken, vom common sense […] angeeignet wird«. Hall, Stuart (2013): Bedeutung, Repräsentation, Ideologie. Althusser und die poststrukturalistische Debatte. Ideologie. Identität. Repräsentation, Ausgewählte Schriften 4. Hamburg: Argument, S. 58. Bedeutungen von Dingen, Praxen, aber auch sozialen Identitäten sind ihnen nicht inhärent, und sie stellen keine zeitlos fixierten Entitäten dar, sondern sie konstituieren sich vor dem Hintergrund spezifischer diskursiver und Macht dominierter Kontexte. Siehe ausführlicher: Hall, Stuart (1997): Introduction, in: Stuart Hall (Hrsg.) (1997): Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage, S. 1–14.
39 Pek, Simon (2023): Learning from Cooperatives to Strengthen Economic Bicameralism*, in: Politics & Society 2023, Vol. 51 (2), S. 258–277.
40 Communia (2023): Öffentlicher Luxus. Eine verheißungsvolle Zukunft. Einleitung, in: communia & BUNDjugend (Hrsg.) (2023): Öffentlicher Luxus, Dietz Berlin, S. 34.
41 Pat, Devine (2002): Participatory Planning Through Negotiated Coordination, in:
Science & Society, 66 (1), S. 77.
42 Lund, Margaret (2011): Solidarity as a Business Model: A Multi-stakeholder Cooperatives Manual, Cooperative Development Center, Kent State University.
43 Vgl. auch mit Pat, Devine (2002): Participatory Planning Through Negotiated Coordination, in: Science & Society, 66 (1), S. 77.
44 Gibson-Graham, J. K. / Dombroski, Kelly (Hrsg.) (2020): The Handbook of Diverse Economies, Cheltenham, UK: Edgar Elgar.
45 Gibson-Graham, J. K. / Dombroski, Kelly (2020): Introduction to The Handbook on Diverse Economies: Inventory as ethical intervention, in: Gibson-Graham, J. K. / Dombroski, Kelly (Hrsg.) (2020): The Handbook of Diverse Economies, Cheltenham, UK: Edgar Elgar, S. 3.
46 Hervorhebung im Original. Roldán Mendívil, Eleonora / Vögele, Hannah (2023): Soziale Reproduktion, Geschlecht und Rassismus, in: Roldán Mendívil, Eleonora /Bafta, Sarbo (Hrsg.) (2023): Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus, Dietz Berlin, S. 8