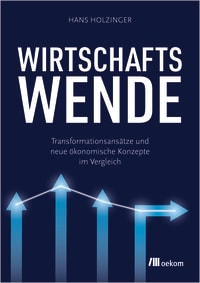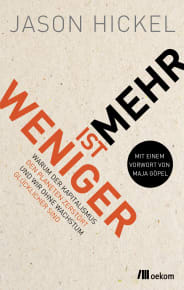Lebensmittel als Übungsfeld für eine Wirtschaft ohne Wachstum
Hamsterkäufe von Nudeln, Konserven und Hefe während der Corona-Krise zeigen, dass sich aktuell viele Menschen um unsere Lebensmittelversorgung sorgen. Welche Alternativen es zum globalen Warenhandel für gute Lebensmittel gibt, darüber unterhielten sich Ursula Hudson von Slow Food Deutschland und der Wachstumskritiker Niko Paech bereits 2015. In der aktuellen Situation sind ihre Überlegungen relevanter als je zuvor.
08.04.2020

Ursula Hudson: Herr Paech, Ihre Ausführungen zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft fand ich schon immer extrem spannend – und gut auf das herunterzubrechen, was Slow Food im Kern antreibt. Skizzieren Sie doch bitte, was die Postwachstumsökonomie, deren bekanntester Vertreter Sie ja sind, ist oder sein soll.
Niko Paech: Die globale Arbeitsteilung und eine bildungspolitisch forcierte Verkümmerung jeglicher Fähigkeiten zur Selbstversorgung machen uns zunehmend verletzlich. Unser Wohlstand kann schnell zum Einsturz gebracht werden, etwa wenn irgendwelche Ressourcen- und Finanzmärkte verrückt spielen. Wir hängen wie Marionetten an den unsichtbaren Fäden der Fremdversorgung. Diese fast schicksalhafte Abhängigkeit steigt mit der Distanz zwischen Produktion und Verbrauch. Die Postwachstumsökonomie ist ein Zukunftsentwurf für die Versorgung des 21. Jahrhunderts und darüber hinaus. Sie ist nicht nur eine Alternative zum Weiter-so, sondern auch zum sogenannten Grünen Wachstum, also dem Versuch, unser Wohlstandsmodell durch technischen Fortschritt oder andere Innovationen von Ressourcenverbräuchen zu entkoppeln. Die Postwachstumsökonomie zielt zunächst einmal darauf, unsere Versorgung graduell und punktuell zu deindustrialisieren und zu deglobalisieren. Denn nur über den Rückbau industrieller Produktionssysteme und die Rückkehr auch zu kleinräumigen und überschaubaren Strukturen lassen sich soziale und wirtschaftliche Stabilität sowie ökologische Verantwortbarkeit herstellen. Wenn man die Idee vom Ende, also von der individuellen Perspektive her denkt, dann gleichen die Lebensstile in einer Postwachstumsökonomie denen von »Prosumenten«, also von Menschen, die nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Diese Menschen leben immer noch unter den Bedingungen des modernen Zeitalters; sie sind gut gebildet und wirken an arbeitsteiliger Produktion mit – sei es in der Fahrzeugindustrie, in der Landwirtschaft, im Bildungs- und Gesundheitswesen oder im Softwarebereich. Aber: Sie arbeiten nicht mehr Vollzeit, sondern – im lebenslangen Durchschnitt – nur noch rund 20 Wochenstunden.
UH: Der Begriff des Prosumenten gefällt mir. Bei Slow Food sprechen wir vom Ko-Produzenten. Der Begriff beschreibt Verbraucher, die nicht nur passiv konsumieren, sondern Interesse zeigen für die Lebensmittel und für die Menschen, die diese erzeugen. Diese Ko-Produzenten unterstützen die Produzenten aktiv durch ihre Kaufentscheidungen und spielen somit eine wesentliche Rolle im Herstellungsprozess.
NP: Prosumenten gehen noch weiter: Die zwanzig freien Stunden sind ein Produktionsfaktor, der benötigt wird, um sich jenseits von Technik, Industrie, Geld, Markt und Staat selbst zu versorgen. Das kleiner gewordene Geldeinkommen wird durch Selbstversorgungsleistungen ergänzt. Man spricht dann auch von »urbaner Subsistenz«, weil das eine moderne Form der Eigenarbeit ist und nicht nach mittelalterlichen Maßstäben beschreibbar wäre. Diese moderne Selbstversorgung umfasst ganz grob drei Kategorien: Als erstes die reine Produktion – hier sind wir sofort bei der Nahrung: Beispiele sind Urban Gardening, Selbstanbau auf landwirtschaftlichen Flächen, Community Supported Agriculture und ähnliche Praktiken.
UH: Wobei die Selbstversorgung bei CSA und ähnlichen Organisationsformen eine größere Rolle spielt als beim Urban Gardening. Diese Formen, von denen es sehr viele gibt, leisten einen echten Beitrag zur Selbstversorgung. Urban Gardening ist ja eher ein politisches Symbol.
NP: Stimmt schon, derzeit ist Urban Gardening noch ein Symbol, aber kein unwirksames. Denn die neuen Gartenaktivitäten stellen sehr bewusst den ungenierten Zugriff auf die Ressourcen dieser Welt infrage. Mehr und mehr Großstadtbewohner lehnen die globalen Verwertungsketten ab und wollen lieber selbst anbauen, kochen und zelebrieren eine neue Genießer-Esskultur. Hier geht es dann auch um das Zubereiten, die Verarbeitung und die Lagerung. Die sogenannten Haushaltstechniken, von denen man früher sprach. Und es gibt noch andere Dimensionen der urbanen Subsistenz: die achtsame Nutzung und Pflege, Instandhaltung und die Reparatur von Dingen. Das sind dann Tätigkeiten an der Schnittstelle von Handwerk, Kunst und Upcycling. Hinzu kommt die Gemeinschaftsnutzung von Gütern. Auf diese Weise ergibt sich eine andere Wertschöpfung. Wir veredeln die Dinge dadurch, dass wir sie gemeinschaftlich nutzen, sie instand halten und reparieren. Die Deindustrialisierung bedeutet nicht, dass wir auf jeglichen technischen Fortschritt verzichten: Wir holen vielmehr aus einer geringeren Menge der Träger des Fortschritts zusätzlichen Nutzen raus, indem wir die Verwendung zeitlich strecken und auf mehr als eine Person ausdehnen. Je mehr Dinge ich selber gestalten kann, je mehr ich sie aus meinen eigenen und den nahegelegenen Ressourcen speisen kann, desto robuster ist mein Dasein, wenn die nächste Finanz-, Energie- oder Umweltkrise auftritt. Das lässt sich mit dem Begriff der Resilienz beschreiben. Schon Ernst Friedrich Schumacher hat vor 40 Jahren in seinem Buch »Small is beautiful« gesagt: In einer Welt mag internationaler Handel durchaus sinnvoll sein, aber erstens in Maßen und zweitens fokussiert auf Luxusgüter, von denen das Überleben nicht abhängt. Güter zur Befriedigung der basalen Grundbedürfnisse sollten hingegen nie vom globalen Handel abhängig sein. Denn wenn der dann zusammenbricht, dann fällt zwar der Luxus weg, aber ich verhungere nicht.

UH: Sie beschreiben in der Gleichzeitigkeit einmal das Kluge, die Veränderung »by design«, und auf der anderen Seite das »Gezwungenwerden«, wenn der Druck zu groß wird oder Desaster eintritt. Es gibt da ja bereits Beispiele, wie so etwas gut funktionieren kann. Für mich ist immer die Landwirtschaft in Kuba ganz erstaunlich: Hier spielte plötzlich Kleinräumigkeit und Regionalität eine große Rolle. Und daraus ergibt sich letztlich auch Vielfalt – ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht.
NP: Da gebe ich Ihnen vollkommen Recht. Ich bin kein Marxist, aber sehr erfreut über das Beispiel, das Kuba geliefert hat. Kuba ist das erste Land auf der Welt, das einen Peak Oil hinter sich gebracht hat, ohne dass es schlimme Verwerfungen gab. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat ja bewirkt, dass keine Maschinen, kein Öl und keine Düngemittel mehr geliefert wurden. Alle haben gesagt, jetzt verhungern die Kubaner. Aber genau das ist nicht passiert. Wir können davon etwas lernen, auch für Griechenland. Aber was sicherlich wichtig ist: Die Kubaner haben nie auf diesem hohen Ross gesessen. Bei ihnen war eine gewisse Improvisationskunst, quasi aus der Not heraus geboren, immer vorhanden – insbesondere auch die Haltung, sich nicht zu schade zu sein, Probleme auch mal ohne Geld zu lösen oder auch die einfachen Lösungen zu akzeptieren. Demgegenüber ist Griechenland, das sich am Traum der europäischen Konsumkultur orientiert hat, ohne eine eigene ökonomische Basis dafür zu haben, umso tiefer gestürzt. Betrachten wir das mal aus der Perspektive der Resilienz: Welche Versorgungsbereiche müssen auch dann noch funktionieren, wenn das Wachstumsregime zusammenbricht? Dann bin ich bei der Nahrungsmittelproduktion. Fast alles andere sind Gebrauchsgüter: Behausungen oder Kleidung kann man über viele Jahre nutzen, wenn man sie pflegt. Mobilität ist derzeit zum großen Anteil Luxus, mit Ausnahmen natürlich. Aber die Ernährung ist ein Verbrauchsgut, das immer wieder neu produziert werden muss. Hier liegt das wahre Resilienzproblem. Produzenten können in der Krise dazu beitragen, das Problem zu entschärfen. Daher müssen wir uns mit den hierzu benötigten Kompetenzen beschäftigen. Die Ernährung ist für eine Wirtschaft ohne Wachstum schon jetzt ein prädestiniertes Handlungsfeld, auf dem sich Kompetenzen und Lebensstile einüben lassen, die ohne industrialisierte Fernversorgung auskommen.
UH: Das ist das einzige, das wirklich Sicherheit bietet. Das merkt ja schon der derjenige, der einen Garten hat, und der, der mit verschiedenen Zutaten kochen kann, dass das Unabhängigkeit und Sicherheit bringt. Was in der Konsequenz dazu führen würde, dass wir wieder ganz unterschiedliche Ernährungsweisen hätten und damit auch eine wesentlich höhere Vielfalt, als es momentan noch der Fall ist.
NP: Die Vielfalt bringt ja nicht nur mehr Stabilität, sondern auch mehr Produktivität. Wenn ich versuche, die verschiedenen Regionen gleichartig zu gestalten, dann vergebe ich regional-spezifisches Potenzial.
UH: Im Moment kann der Einzelne nur die vielfältigen Strukturen, die entstanden sind, unterstützen und raus, dem Großen gehen. Mein Lieblingspunkt der von Slow Food Youth zusammengestellten »10 Sofortmaßnahmen für ein gutes, sauberes und faires Lebensmittelsystem« lautet: Kaufe Lebensmittel ohne Strichcode. Dann ist man gleich raus aus dem großen System. Darum geht es ja. Toll finde ich, dass es gerade die jungen Leute sind, die mit dem Gestalten beginnen. Vor einiger Zeit habe ich einen Mann aus Schweden kennengerlernt, der jungen Leuten in Workshops dabei hilft zu lernen, wie man Dinge repariert. Er kommentierte das mit dem Ausspruch: »Es ist schon sehr lustig, wir haben gerade die erste Generation, die überhaupt nicht mehr mit den Händen arbeiten kann. Und die beginnt jetzt nähen zu wollen oder Geräte zu reparieren, Fahrräder zu bauen und so weiter.« Das finde ich sehr zukunftsweisend. Als Einzelner raus aus dem System, darum geht es. Wenn wir uns jetzt das Ernährungsfeld anschauen: Wie würde sich das auf ein Bildungssystem auswirken?
NP: Unser Bildungssystem muss sich grundlegend ändern. Es darf nicht mehr nur globalisierungs-, industrie- und technologiekompatibel sein; es geht um handwerkliche, manuelle, substanzielle, ja sogar künstlerische Fähigkeiten. Weiterhin ist eine Nachhaltigkeitsbildung vonnöten, die vermittelt, wie ein Dasein möglich ist, ohne über unsere Verhältnisse zu leben – eine Erziehung zur Verantwortung, die klarstellt, das alles, was wir konsumieren oder an digitalem und mobilitätsbasiertem Wohlstand in Anspruch nehmen, nie zum ökologischen Nulltarif zu haben ist. Noch wichtiger als herkömmliche Bildung ist Übung. Eine Schule braucht zwingend einen Schulgarten und eine eigenständige Nahrungsmittelverarbeitung, an der die Schüler beteiligt werden. Das legt die Basis zum Prosumentendasein. Aber das macht auch Freude, hier gibt es Erfolgserlebnisse und Anerkennung. Das steigert persönliche Fähigkeiten und trägt jenseits von Konsum zur Selbstverwirklichung bei.
UH: Wir haben das Thema Suffizienz noch nicht diskutiert. Hier stellt sich mir immer die Frage: Wer bestimmt eigentlich, was genug ist?
NP: Das ist doch einfach, wie sich am Dauerthema Klimaschutz zeigt! Alle zivilisierten Gesellschaften haben das 2-Grad-Klimaschutziel akzeptiert. Dieselbe Logik gilt ja für andere irdische Ressourcen, die begrenzt sind. Diese Grenzen lassen sich herunterbrechen: Was darf sich ein Einzelner noch herausnehmen, ohne über seine Verhältnisse zu leben? Das müsste man natürlich für Wasser, Coltan, Kupfer, Fläche und vieles andere auch machen. Fangen wir doch mal beim Klimaschutz an, den angeblich jeder will. Ich hätte dann pro Jahr ca. 2,7 Tonnen an CO2-Kontingenten und es ist längst kinderleicht, die Durchschnittswerte für die Produkte und Alltagsaktivitäten zu ermitteln. Nun kann ich selbst entscheiden, an welcher Stelle ich genug einspare, um mir an anderer Stelle etwas an emissionsintensiven Gütern zu leisten. Individualisierung und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten würden darunter kaum leiden, sondern nur auf einem quantitativ reduzierten Niveau ausgelebt. Aber ist das Verzicht? Tatsächlich geht's um Entrümpelung, Entschleunigung, Freiheit von Stress und Reizüberflutung: ein Abwurf von Ballast, der Geld, Zeit, Raum und Umwelt kostet. Zufriedenheit entsteht durch eine Konzentration auf das Wesentliche, anstatt sich maßlos mit Selbstverwirklichungsoptionen zu überhäufen, für deren Glück stiftende Nutzung die Zeit fehlt – und individuelle Zeit ist nicht vermehrbar. Die Beschränkung auf weniger Dinge, deren Besonderheiten ich dadurch erst ausschöpfen kann, bedeutet für mich die Rückkehr zum Genuss. Dies verlangt jene Achtsamkeit, die ich bei Slow Food immer wieder beobachten kann. Dadurch wird eine Praxis vermittelt, die nicht nur einem selbst zugutekommt, sondern auch der ökologischen und sozialen Zukunftsfähigkeit des großen Ganzen dienlich ist.
Dieses Interview erschien erstmals im Januar 2015 im Slow Food Magazin.
Mehr Anregungen zu einer neuen, nachhaltigen Lebenaweise finden Sie in unseren Buchtipps zur Postwachstumsökonomie.